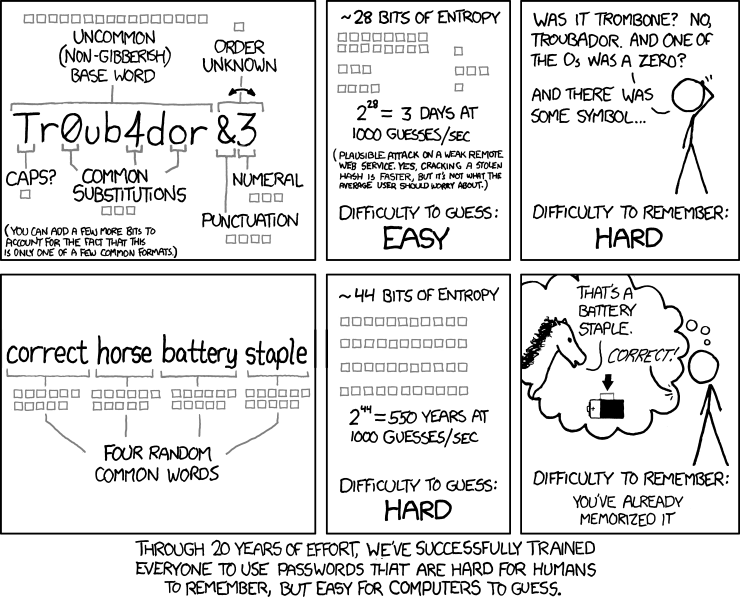Seit ich kürzlich einige Missverständnisse zur Blockchain aufgezählt habe, haben Leute eine perverse Freude daran, mir Artikel mit teils absurden Blockchain-Lobpreisungen zuzuschicken. Jemand designte sogar ein T-Shirt, das mir in den meisten Fällen angemessen angemessen erscheint.

Aber ich habe erkannt: Es gibt eine Menge weiterer Missverständnisse, und sie verbreiten sich massenhaft ohne nennenswerten Widerspruch. Es ist eine Melange aus etwas Mathematik, viel Esoterik und Wall Street-Denken entstanden. Also lege ich hier mal ein paar Erklärungen nach.
Das Dezentralitäts-Paradox
Blockchains sind — im Prinzip — eine dezentrale Technik. Das alleine scheint schon viele Leute von der Technik zu überzeugen. So fantasiert zum Beispiel Philippe Wampfler in seinem Blog über eine Bildungsrevolution — dank Blockchain. Da ich seit über 20 Jahren Dezentralität im Internet verfechte, bin ich nicht ganz so leicht überzeugt.
Zum einen: Sehr dezentral sind Blockchains in der Praxis gar nicht. Die Mining-Kapazitäten der Bitcoin-Blockchain liegen in der Hand von einer Handvoll Miner, die reichlich Kontogebühren für ihre kryptographischen Dienste verlangen. Die ganzen Tokens, die nun im ICO-Verfahren verkauft werden, sind meist furchtbar zentral. Selbst wenn die ausgebende Firma ihre Krypto-Einheit nicht völlig selbst in Eigenregie minen will, obliegt ihr die volle Kontrolle darüber, wie Geld in das System fließt, welche Preise sie setzt und wer zu welchen Bedingungen an eventuellen Umsätzen beteiligt wird. (Da es eigentlich fast nirgends echte Umsätze gibt, ist die Frage erst mal nur von theoretischer Bedeutung.)
Dezentralität bedeutet auch generell nicht, dass die Macht eines Systems automatisch in die Hände der vielen übergeht. Nein. Für den einzelnen ohne Macht hat Dezentralität viele Nachteile. Wer jemals einen Joint mit Bitcoins gekauft hat, kann sich mittlerweile ziemlich sicher sein, dass eine staatliche Stelle darüber Bescheid wissen kann. Dezentralität verhindert schnelle Updates, und die Sicherheitslücken müssen die Nutzer als erstes ausbaden. Dezentralität gibt den Leuten viel Macht, die die Imperfektionen des Ist-Zustands ausnutzen und die große Mehrheit übervorteilen wollen. (Simples Beispiel: E-Mail-Spam.)
Dezentralität alleine bietet auch keine Sicherheit. Wer gerne im dezentralen Internet Relay Chat unterwegs ist, weiß dass die Komplikationen doch um einiges höher sind als bei WhatsApp. Und von einer End-zu-End-Verschlüsselung kann man nur träumen. (Bei XMPP kann sie funktionieren, es ist aber eine Heidenarbeit.)
Dezentralität setzt meist auch eine Zentralität voraus. Jeder muss sich strikt an ein Protokoll halten, damit auch jeder Knoten in dem weiten Netz die selben Daten auf die selbe Weise interpretieren kann. Wenn zum Beispiel Philippe davon fantasiert, dass die Blockchain zentrale Institutionen im Bildungsbereich überflüssig machen kann, ist er auf dem Holzweg. Eine Dezentralität setzt sogar eine im Bildungsbereich bisher unbekannte Zentralität voraus. Wenn Bildungsabschlüsse auf der ganzen Welt in eine gemeinsame Datenbank eingespeist werden sollen, dann muss auch die ganze Welt einig sein, wann eine Prüfung bestanden ist und wann nicht. Und welche Inhalte zu jedem Abschluss gehören. Wenn das nicht gegeben ist, kann auch die Blockchain nichts ändern.
Dezentralität ist wichtig, sie ist die Grundlage des World Wide Web, des Internets. Damit sie funktioniert, darf man sie aber nicht nur als Hype, als selbst erfüllenden Slogan begreifen. Dezentralität ist viel Arbeit. Und wenn niemand wirklich ihre Notwendigkeit versteht, bleibt sie halt unerledigt. Oder man überlässt es Google, Flash abzuschaffen und Verschlüsselung durchzusetzen. Aber ich schweife ab…
Blockchains können lügen
Einer der anderen großen Marketing-Slogans der Blockchain-Gemeinde heißt: Vertrauen. Was in der Blockchain abgespeichert ist, ist mathematisch so gesichert, dass sich auch Leute darauf verlassen können, die nie voneinander gehört haben. Oder noch besser: Leute können einander vertrauen, wenn sie schon eine Menge voneinander gehört haben und dem anderen aus guten Gründen keinen Gebrauchtwagen abkaufen würden. Denn die Mathematik ersetzt das Vertrauen.
Das mag für Bitcoins einigermaßen zutreffen. Aber halt nur deshalb, weil hier schlichtweg abstrakte Zahlen anderen abstrakten Zahlen zugeordnet werden. So lange man nur dies erreichen will, ist die Blockchain wohl ein gutes Prinzip.
Doch man muss sich auch die Grenzen des Konzepts vergegenwärtigen. Zwar ist bisher ziemlich sicher, dass ein Betrag X von Konto A auf Konto B überwiesen wird. Das Konto B kann aber per Hack rückstandslos leergeräumt werden. Oder durch einen Dienstleister, der mal eben pleite macht. Oder durch eine Festplatte, die auf der Müllkippe landet. Sobald man sichergehen will, dass ein Betrag X nicht mehr nur dem abstrakten Konto B, sondern einer bestimmten Person zu Gute kommt, ist die Blockchain bisher nicht sonderlich erfolgreich.
Steve Wozniak beschwerte sich zum Beispiel gerade, dass ihm Bitcoins gestohlen wurden. Jemand kaufte ihm die Bitcoins ab, die genutzte Kreditkarte war jedoch gestohlen. Die Blockchain hat den Kauf final registriert, die Kreditkartenfirma jedoch nicht. Ergebnis: Wozniak ist sein Geld los. Und er hat auch keine Aussicht darauf, das Geld zurückzubekommen, obwohl die Beute für jedermann sichtbar in der Blockchain ausliegt.
Dieses Problem ist nicht unbedingt spezifisch für eine Blockchain: Datenbanken vermerken nur, was man in sie eingibt. Wenn jemand bei der Eingabe lügt oder sich auch nur irrtümlich vertippt, dann kann die Datenbank nichts dafür. Die Blockchain verhindert aber recht effektiv, dass Fehler nachträglich korrigiert werden könnten.
Kurzum: Um die dezentrale Technik Blockchain nutzbar zu machen, muss man in den allermeisten Fällen so viel Zentralität voraussetzen, dass das Abspeichern in der Blockchain eh keinen Unterschied mehr macht. Man kann dann auch jede andere Datenbank einsetzen und das Ergebnis ist billiger, verlässlicher und weniger missbrauchsanfällig.
Mit der Verbreitung von „Smart contracts“ wird das Ganze noch schlimmer. Denn die Leute, die diese neuen Super-Verträge schreiben sollen, scheitern heute wahrscheinlich schon mit PHP. Und hier wie da werden Fehler ignoriert, bis es zu spät ist.
Blockchains sind kein Super-Kopierschutz
Auch diese Idee ist mittlerweile erstaunlich populär: Blockchains retten den Urheber. Dank der neuen Technik kann nun endlich Wissen sicher gehandelt werden. So hat zum Beispiel die Bundesregierung eine Studie ausgeschrieben, die die Blockchain als Grundprinzip eines Wissen-Marktplatzes erkunden soll.
Manche versuchen per Blockchain schon wieder eine art Leistungsschutzrecht zu etablieren. So schreibt die „Welt“.
Das Prinzip Blockchain dürfte das Internet grundlegend verändern. Heute können digitale Wirtschaftsgüter wie etwa Musikstücke beinahe mühelos kopiert und verteilt werden. In der Blockchain-Welt geht das nicht mehr. Alle Transaktionen werden in einem Kassenbuch abgespeichert – und dann Zeile für Zeile verschlüsselt und dabei mit den vorigen Daten verkettet. Dadurch sind einmal geschriebene Daten nicht mehr veränderbar.
Wir könnten Steuergeld sparen, wenn die Bundesregierung einfach diese Antwort akzeptierte.
Nein. Neinneinnein. Nein. Nein! NEIN! Nein. Nein. Neinneinnein. Nein. NEIN! Und: Nein.
Zum einen: Mein Broterwerb besteht daraus, urheberrechtsgeschützte Texte zu produzieren. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass ein Urheberrechtsstreit daran scheitert, dass jemand das Entstehungsdatum eines Inhalts nicht hinreichend dokumentieren kann. Die Blockchain ist hier eine Lösung für ein Problem, dass es in der Praxis eigentlich nicht gibt.
Zum zweiten: Blockchains setzen Offenlegungen voraus. Wenn alle Geschäfte mit urheberrechtlich geschützten Material in einer öffentlich zugänglichen Plattform liegen, dann kann auch jeder sehen, welche Zwischenhändler wie viel einsteckt. Ich glaube nicht, dass dies im Sinne der Zwischenhändler ist – und in dem Fall würden sie einfach nicht mitmachen. Und falls doch: Durch die prominente Veröffentlichung numerischer Werte ohne Kontext würde das Apple-Problem verstärkt: Seit Steve Jobs beschlossen hat, im App-Store 30 Prozent Provision zu nehmen, will niemand anders weniger als 30 Prozent nehmen.
Zum dritten: Wenn man Inhalte erst registrieren muss, um Urheberrechtsschutz zu genießen, dann wird eine Menge Material nicht mehr geschützt werden, weil der Aufwand doch immer beträchtlich ist.
Zum vierten: Die Tauglichkeit der Blockchain als Kopierschutz hängt an einer simplen Tatsache: Sie ist kein Kopierschutz. Zwar könnte man zum Beispiel eine DVD-Ausgabe der Titanic auslesen und in der Bitcoin-Blockchain abspeichern. Das Problem daran ist: Jeder kann auf diese Weise den Film auslesen und den Rest der Blockchain ignorieren. Statt Raubkopien zu verhindern, liefert die Blockchain jedem Interessierten die Daten frei Haus. Zudem: Wer soll all den Kram auf Tausenden von Nodes abspeichern wollen?
Theoretisch kann man sicher ein System erdenken, dass auf jedem Blu-Ray-Player und jeder Streaming-Box installiert wird, und das Inhalte erst abspielen will, wenn eine Zahlung auf irgendeiner Blockchain registriert ist. Stattdessen kann man aber auch jeden anderen Kopierschutz nehmen, der viel einfacher zu installieren, zu updaten, zu kontrollieren ist. Hier gilt wie so oft: Wenn man es mal geschafft hat, die Blockchain zum Laufen zu bekommen, ist sie wahrscheinlich allen anderen etablierten Lösungen unterlegen.